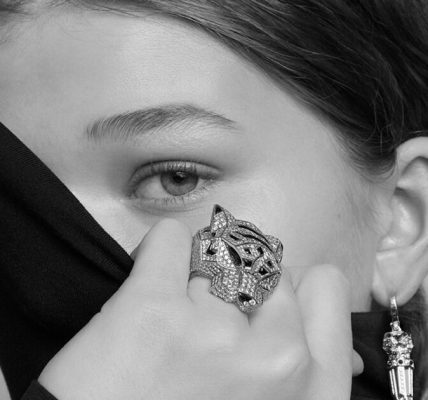Wir haben anlässlich des diesjährigen Muttertags in unserem Archiv der MADAME gestöbert und eine tolle und aktuellere Geschichte denn je über das Muttersein gefunden. Aufgeteilt in zwei Geschichten, kommt hier nun Teil zwei von Autorin Kerstin Holzer mit ganz persönlichen Einblicken in die Erziehung ihres Sohnes und über die Gender-Debatte.
Teil 2 von Autorin Kerstin Holzer
Diesen Frühling schreibt mein Sohn sein Abitur, im Sommer wird er 18 Jahre alt, und im Herbst wird er wahrscheinlich das Nest verlassen. Ich bin nicht ganz sicher, ob ich ihn ausreichend auf die Welt vorbereitet habe.
Er kann zwar proteinreiche Sportler-Shakes für mehr Muckis zu-bereiten, aber keine Spaghetti Bolognese. Er besteht auf Boxershorts, kann sie aber nicht bügeln. Er kann auch keinen
Fahrradreifen flicken oder einen Knopf annähen.
Macht mir das Sorgen? Nicht wirklich. All das ließe sich in einer Woche spielend lernen. In den vergangenen 17 Jahren ging es
mir in Erziehungsfragen um andere Dinge.
Als Lion auf die Welt kam, hatte die
Pisa-Studie gerade den Katastrophenfall für Jungs ausgerufen: Sie galten
plötzlich als schulische Bildungsverlierer, abgehängt von zielstrebigen, kontrollierten Mädchen. Umgeben von einer Heerschar immer mehr
alleinerziehender Mütter, fehlten ihnen
zudem in Kindergärten und Schulen
männliche Role Models, hieß es. Typisch männliches Verhalten (über den
Kopf gezogene Federmäppchen!) würde geahndet, möglichst lautlose soziale Geschmeidigkeit (typisch
weiblich?) hingegen belohnt. Im Laufe der letzten Jahre, spätestens seit #MeToo, ist das klassische Mannsein dann immer weiter unter Beschuss geraten. In der modernen Gender-Debatte
heißt raubeinige, aggressive Männlichkeit jetzt „toxic masculinity“, die American Psychological Association (APA) rückte sie 2018
in die Nähe psychischer Krankheiten mit hohem Risikofaktor für
Isolation, Suchtgefahr, Gewalt.
Dass Männlichkeit als Problemfall gilt, kann eine ziemliche
Bürde sein, wenn man heute einen Jungen großzieht. Vor allem,
wenn man wie ich einige Jahre lang alleinerziehend ist. Die gut
informierte und von massenhaft Ratgebern verunsicherte Mutter
weiß, dass sie ihrem Sohn ein positives Männerbild vermitteln
muss – nur leider nicht, wie. Ich behalf mir damals mit einem Großvater, der im Laufe seines Lebens die wundersame
Wandlung vom toughen Manager zum liebevollen Geduldsengel
durchlaufen hat. Ich schickte meinen Sohn zum Kinder-Kung-
Fu, wo er bei einem ultrastrengen Trainer nicht nur seine Kraft
kennenlernte, sondern auch wie man sie diszipliniert einsetzt. Ich
guckte mit ihm alte Filme, deren Männerbild mir sympathisch
war: „Der rote Korsar“ mit einem Burt Lancaster, bei dessen Lachen einem das Herz aufgeht, „Rio Bravo“, wo Freundschaft und Tapferkeit über das Böse siegen, und „Die Ferien des Monsieur Hulot“, dessen rührende Ritterlichkeit sogar meinen Neunjährigen ergriff. Ich ließ ihn außerhalb des Faschings als Lucky Luke mit der Spielzeugpistole knallen und hielt ihn fern von reformpädagogischen Parallelwelten, wo stilles
Püppchenfilzen gefragt ist.
„Es stimmt nicht,
dass Männlichkeit
auf dem Prüfstand
steht, sondern nur
rücksichtsloses
Primatengebaren
“
Aber ich ließ ihn auch kräftig mit anpacken, wenn ich Hilfe brauchte (Katzentoilette säubern, Weihnachtsbaum schleppen …). Überhaupt war ich recht streng, als es noch Eindruck machte. Ich dachte mir: besser früh klarstellen, dass
Frauen was zu sagen haben und Respekt verdienen. Mit der Vorstellung, dachte ich, wäre er in der Zukunft ganz gut beraten.
Vielleicht ist es nämlich heute überhaupt nicht schwerer, ein
Mann zu werden. Es ist seit #MeToo nur schwerer, als übergriger Macho durchs Leben zu pflügen, der zu Hause die Füße hochlegt, während die Hausfrau darunter staubsaugt. Es stimmt auch
überhaupt nicht, dass Männlichkeit auf dem Prüfstand steht,
sondern nur rücksichtsloses Primatengebaren. Genau besehen, ist
es eine prächtige Zukunft, auf die sich unsere Söhne freuen können: Männer werden mehr von ihren Kindern haben, weil sie Elternzeit beantragen können, und beim Geldverdienen werden sie
von ihren Frauen partnerschaftlich entlastet. Sie dürfen zart,
poetisch, gefühlvoll sein und trotzdem erfolgreich – wenn sie
mögen. Und wenn sie Lust haben, dürfen sie sich die Fingernägel lackieren und gelten trotzdem als coole Hunde. Es ist auch die
Aufgabe von Müttern, ihre Jungs zu Männern zu erziehen, die all
das zu schätzen wissen.
Seit mein Sohn 14, 15 Jahre alt ist, finde ich seine Jugend in
der heutigen Welt allerdings doch manchmal schwerer als zu meinen Teenagerzeiten. Aber das ist sie auch für Mädchen. Die Dauerkontrolle durch WhatsApp und Instagram erschwert, was für
Heranwachsende so verdammt wichtig ist: ausbüxen und unbeobachtet bleiben beim Träumen, Flirten, Fehlermachen. Auch der
Zwang zur Selbstoptimierung ist nicht nur für jugendliche
GNTM-Zuguckerinnen, sondern auch für Jungs ein Fluch. Da
hilft nur eins: den Kindern vorleben, dass Unperfektion das Dasein erst unterhaltsam macht. Das gelingt meinem Mann und mir nun wirklich ganz gut.
Als ich vor 18 Jahren erfuhr, dass ich
einen Jungen erwartete, war ich sofort
begeistert. Erstens hat mir das Konzept
von Feuermachen, Zelten und Westerngucken schon immer mehr Spaß
gemacht als Backen und Zöpfeflechten.
Und zweitens fiel es mir mit einem
Sohn leichter, das Prinzip Erziehung zu
begreifen: Ein Kind ist eben keine Verlängerung seiner selbst, kein
„Mini-Me“. Es soll, darf, muss anders sein können. Erziehung bedeutet auch, dass man Misserfolge und Kummer des Kindes aushält, statt sofort mit Lösungen einzugreifen. Wie soll es sonst lernen, dass es Kraft aus sich selber schöpfen kann?
Ist mein Sohn nun schon erwachsen? Ich schätze, nein. Sein
Zeitmanagement ist eine Katastrophe, für Klausuren wird erst spät
in der Nacht gelernt, nach vertrödelten Nachmittagen. Ich verstehe auch nicht, wie man umgeben von den achtlos zu Boden
geworfenen Klamotten einer Woche (alle Pulliärmel auf links gedreht) in Ruhe lesen kann. Seiner Mutter gegenüber spart er nicht
an flapsigen Bemerkungen. Aber dafür trägt Lion den alten Nachbarn die Einkaufstüten in den dritten Stock. Wenn er auf dem
nächtlichen Heimweg von einer Party in der U-Bahn ein fremdes, angetrunkenes Mädchen aufliest, das von seinen Freundinnen sich selbst überlassen wurde, bringt er es nach Hause und
übergibt es seinen dankbaren Eltern. Er interessiert sich für Motorräder, Soul der 80er und will unbedingt nach Tokio. Und: Er
hat neben seine Kumpeln auch platonische Freundinnen, die er
ziemlich cool findet. Ja, auch ich habe Hoffnung.
Und Knöpfe kann ich selbst nicht annähen.
Hier gehts zu Teil 1 von Chefredakteurin Petra Winter mit ganz persönlichen Einblicken in ihre Familie